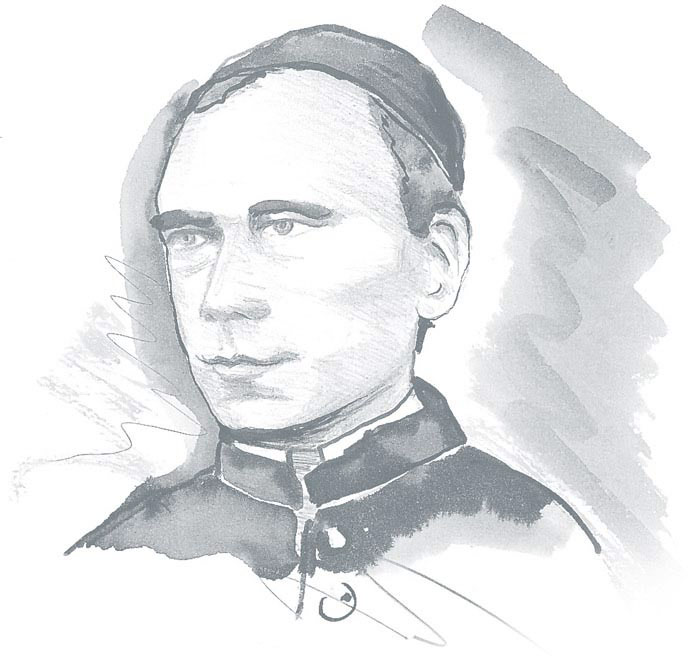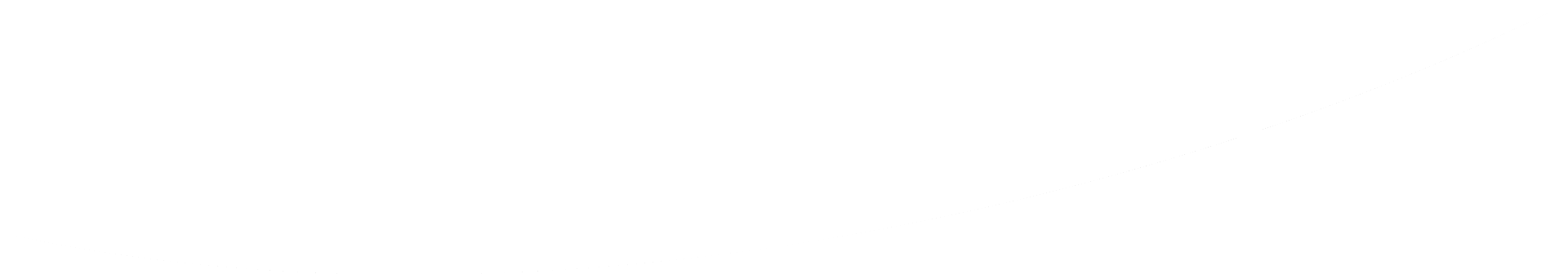|
Verbandsstruktur
Die kleinste organisatorische Einheit ist die Kolpingsfamilie.
Sie will eine Gemeinschaft sein, in der Menschen aus allen
Altersgruppen partnerschaftlich und familienhaft miteinander
umgehen. Die Mitglieder möchten aktiv an der Erneuerung
unserer Gesellschaft mitgestalten.
Dazu will die Kolpingsfamilie den Einzelnen befähigen,
als Christ sein Leben, in Familie, Beruf und Staat
verantwortungsbewußt zu gestalten.
Eine Kolpingsfamilie ist keine ”geschlossene Gesellschaft”,
sondern lädt zum aktiven Mittun ein!
Mehrere Kolpingsfamilien einer Region können
sich zu einem Bezirksverband zusammenschließen.
Das macht es möglich, Veranstaltungen und Aktionen
durchzuführen, die für eine einzelne Kolpingsfamilie
nicht in Frage kommen.
Alle Kolpingsfamilien eines Bistums bilden gemeinsam
einen Diözesanverband.
In Deutschland gibt es 27 Diözesanverbände,
die das Kolpingwerk Deutschland mit insgesamt 275.000
Mitgliedern in 2.800 Kolpingsfamilien bilden.
Die einzelnen Nationalverbände haben sich wiederum
im Internationalen Kolpingwerk zusammengeschlossen.
Derzeit ist das Kolpingwerk weltweit in
rund 50 Ländern vertreten. Ein Nationalverband entsteht
aber erst, wenn eine Mindestanzahl an Kolpingsfamilien
die Gewähr für eine beständige Arbeit bietet.
Einrichtungen
Die Geschichte des Kolpingwerkes
Für nahezu ein Jahrhundert bleibt der Verband durch
die Zielgruppe der ledigen Handwerksgesellen und
die Grundlinien der praktischen Verband- sarbeit geprägt.
Die beruflich bedingte Wanderschaft führte die Gesellen
in viele Gesellenvereine. Dadurch entstand ein lebendiges
Verbandsbewußtsein. Weite Verbreitung finden die
Einrichtungen wie Gesellenhäuser, Spar-, Kranken-, Sterbekassen.
Weitere Gesellen- vereine entstehen ortsbezogen,
die Verbandsstruktur mit Diözesan- und Zentralverbänden
bildet sich heraus. Der katholische Gesellenverein versteht
sich als Teil der katholischen Sozialbewegung; er steht
damit in den damaligen Auseinandersetzungen
um Sozialpolitik, Hand- werksorganisation und Gewerkschaftsfrage.
Nach dem 1. Weltkrieg wirken sich die allgemeinen
Demokratisierungs- tendenzen auch im Verband aus; so erhalten die Gesellen weitere Mitwirkungsmöglichkeiten. Mit der Machtergreifung
durch den National- sozialismus wird die Verbandsarbeit
behindert, zum Teil verboten. Viele Kolpingsfamilien
ziehen sich in den innerkirchlichen Raum zurück, in der DDR
bis zum Fall der Mauer.
Nach 1945 beginnt der Neuaufbau in der
Bundesrepublik Deutschland auf neuen Fundamenten,
wie sie bereits 1933 zugrunde gelegt worden sind.
Neben den Gesellenvereinen (Gruppe Kolping) steht
jetzt die Gruppe Altkolping, frühere Ehemalige, die bis
dahin aufgrund von Heirat und wirtschaftlicher Selbständigkeit
aus dem Verband ausscheiden mußten. Beide Gruppen bilden
die Kolpingsfamilie. Ein besonderer Wandlungsprozess
prägt seither die Verbandsgeschichte.
Zunehmend finden Menschen, die nicht zur traditionellen
Zielgruppe gehören und aus unterschiedlichen Berufen
und sozialen Schichten kommen, Interesse an der
pfarrbezogenen Kolpingsfamilie. Diese versteht sich
jetzt als familienhafte und generations-übergreifende Gemeinschaft.
Eine weitere Öffnung erfolgt durch die Gründung der Gruppe
Jungkolping und Aufnahme weiblicher Mitglieder im Jahre 1966.
Auf dem Hintergrund gesellschaftlicher und kirchlicher
Wandlungen hat sich dieser Prozess in den Kolpingsfamilien
entwickelt und dann durch Programm und Satzung seine
verbandliche Absicherung gefunden. Mit der
Beschlussfassung über die “Aktion Brasilien” 1968 erfolgt
eine rasche Ausbreitung des Verbandes im internationalen
Bereich. Weltweit gelingt es, die Ideen Kolpings in
unterschiedlichen Nationen und Kulturen umzusetzen
und wirksam werden zu lassen. Seit der
Wiedervereinigung 1990 besteht das
Kolpingwerk Deutschland wieder als gesamtdeutscher Bundes- verband.
|